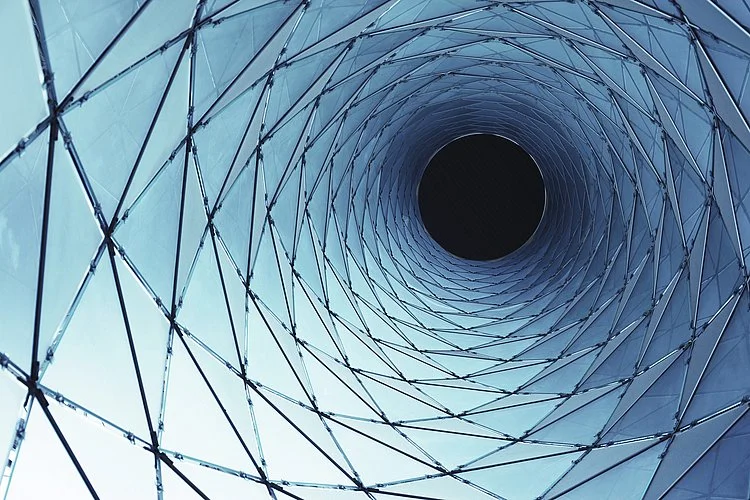Gesellschafterdaten offen: BGH stärkt Auskunftsrecht im Konflikt zur DS-GVO
Update Investmentfonds Nr. 44
Der BGH stellt klar: Ein Auskunftsersuchen des Gesellschafters, das auch dem Ziel dient, die Namen, Anschriften und Beteiligungshöhen der Mitgesellschafter dazu zu verwenden, diesen Kaufangebote für ihre Anteile zu unterbreiten, stellt keine unzulässige Rechtsausübung und keinen Missbrauch des Auskunftsrechts dar. Einem solchen Auskunftsbegehren stehen auch nicht die Regelungen der Datenschutz-Grundverordnung entgegen (BGH, Beschluss vom 22.1.2025 - II ZB 18/23).
Zum Hintergrund
Der BGH billigt in ständiger Rechtsprechung dem Gesellschafter einer Personengesellschaft das Recht zu, seinen Vertragspartner zu kennen. Dieses Recht kann im Widerspruch zu dem Interesse des betroffenen Gesellschafters stehen, seine personenbezogenen Daten geheim zu halten. Einen Konflikt mit der Datenschutz-Grundverordnung (die „DS-GVO“) sah auch das Amtsgericht München, welches zwei Verfahren aussetzte und sie dem EuGH vorlegte.
In den Ausgangsverfahren forderten die Kläger von den beklagten Treuhandkommanditistinnen die Preisgabe von Namen und Adressen aller mittelbar über die Treuhänderin beteiligten Mitgesellschafter. In den Treuhandverträgen zwischen Treuhandkommanditistin und mittelbaren Mitgesellschaft war ein Verbot der Weitergabe dieser Daten vereinbart.
Der EuGH entschied am 12. September 2024, dass die Daten nicht weitergegeben werden dürfen, wenn der maßgebliche Vertrag die Weitergabe dieser personenbezogenen Daten an andere Anteilseigner ausdrücklich ausschließt.
Zum Sachverhalt
Der Kläger war mit der Beklagten, einer Treuhandkommanditistin, über einen Treuhandvertrag verbunden und so mittelbar an zwei Fondsgesellschaften beteiligt. Nach den Gesellschaftsverträgen der Fondsgesellschaften sollten die Bestimmungen der Gesellschaftsverträge für die Treugeber, also u. a. dem Kläger, entsprechend gelten. Zudem waren die Treugeber von der Treuhandkommanditistin laut Gesellschaftsvertrag ermächtigt, ihre Mitgliedsrechte im Umfang ihrer Treuhandeinlage selbst auszuüben, insbesondere an Gesellschaftsversammlungen teilzunehmen.
Mit anwaltlichem Schreiben verlangte der Kläger von der Beklagten Auskunft über die persönlichen Daten und die Beteiligungshöhen sämtlicher Gesellschafter, also der Treugeber Kommanditisten und der unmittelbar beigetretenen Kommanditisten. Sie benötigte die Auskunft, um ihre Mitgliedsrechte informiert ausüben zu können und um anderen Gesellschaftern Kaufangebote zu unterbreiten. Die Beklagte verweigerte die Herausgabe der Informationen.
Das Landgericht hat die Beklagte antragsgemäß verurteilt. Die dagegen gerichtete Berufung der Beklagten hat das Berufungsgericht nicht zugelassen und als unzulässig verworfen. Hiergegen richtet sich die Rechtsbeschwerde der Beklagten, die keinen Erfolg hat.
Die Entscheidungsgründe
Der zweite Zivilsenat des BGH weist die Rechtsbeschwerde als unbegründet zurück.
Dem Gesellschafter steht ein Auskunftsrecht zu
Wie der BGH spätestens seit 2013 in laufender Rechtsprechung feststellt, steht dem Gesellschafter einer Personengesellschafter das Recht zu, seinen Vertragspartner zu kennen. Das Auskunftsrecht stehe auch einem Treugeber zu, der einem unmittelbar beteiligtem Gesellschafter gleichsteht. Es finde seine Grenzen im Verbot der unzulässigen Rechtsausübung (§ 242 BGB) und im Schikaneverbot (§ 226 BGB). Das Auskunftsrecht umfasse Namen und Anschrift der Mitgesellschafter und deren Beteiligungshöhen. Ein Gesellschafter müsse wissen, wie die Stimmen und damit die Machtverhältnisse innerhalb der Gesellschaft verteilt sind, um seine Mitgliedschaftsrechte informiert ausüben zu können.
Erstmals stellte der BGH klar, dass es keine unzulässige Rechtsausübung und keinen Missbrauch des Auskunftsrechts darstelle, wenn der Gesellschaft die Daten der Mitgesellschafter „auch“ dazu verwenden möchte, „diesen Kaufeingebote für ihre Anteile zu unterbreiten“. Auch stellte das Gericht erstmalig fest, dass eine das Auskunftsrecht beschränkende Vereinbarung unwirksam sei gem. § 166 Abs. 2 HGB. Danach ist eine Vereinbarung im Gesellschaftsvertrag, welche die Auskunftsrechte eines Gesellschafters nach § 166 Abs 1 HGB ausschließt oder beschränkt, unwirksam.
Die Auskunft ist DS-GVO konform
Der BGH stellt fest, dass die Übermittlung der personenbezogenen Daten rechtmäßig sei gem. Art. 6 Abs. 1 UAbs. 1 b) DS-GVO. Die Übermittlung sei zur Erfüllung des
Vertrages zwischen Treugeber und Treuhandkommanditistin erforderlich. Hierbei differenziert der BGH nach dem Grund des Auskunftsbegehrens:
- Dient die Auskunft der Durchsetzung von Mitgliedsrechten und dem beabsichtigten Kauf von Anteilen, sei eine direkte Kommunikation mit dem Mitgesellschafter erforderlich und daher die Auskunft von Namen, Anschrift und Beteiligungshöhe.
- Dient die Auskunft ausschließlich dem Unterbreiten von Kaufangeboten, so sei eine direkte Kommunikation und damit die Weitergabe der Daten der Mitgesellschafter nicht erforderlich. Die Gesellschaft könne in diesem Fall die Anfrage des Gesellschafters an die Mitgesellschafter weiterleiten.
Kein Widerspruch zum Urteil des EuGH vom 12. September 2024?
Der EuGH entschied im vergangenen Jahr, dass eine Weitergabe der personenbezogenen Daten nicht zulässig sei, wenn die Beteiligungs- und Treuhandverträge untersagen, die Daten der mittelbaren Gesellschafter den anderen Gesellschaftern mitzuteilen. Dann lege der Rechtfertigungsgrund des Art. 6 Abs. 1 UAbs. 1 b) DS-GVO nicht vor. Das Mitteilen der Daten sei nicht erforderlich zur Erfüllung des Vertrags.
Im starken Kontrast zum BGH sieht der EuGH das wesentliche Merkmal einer mittelbaren Beteiligung an einer Publikumsfondsgesellschaft gerade in der Anonymität der Gesellschafter, auch im Verhältnis der Gesellschafter untereinander. Die betreffenden Personen entschieden sich für eine vertrauliche Behandlung ihrer Daten durch den Investmentfonds.
Indessen möchte der BGH sich der Wertung durch den EuGH nicht anschließen, denn die Sachverhalte der jeweiligen Entscheidung seien unterschiedlich:
- In den Fällen des EuGH bliebe unklar, ob die Treugeber den unmittelbar beteiligten Gesellschaftern gleichgestellt sind. Hierzu fehlen Angaben im Urteil und in den Vorlagebeschlüssen des AG München.
- Im Fall des BGH sei nicht ersichtlich, dass der Treuhandvertrag die Weitergabe von personenbezogenen Daten der Gesellschafter verbiete.
Ausblick
Der BGH führt seine Rechtsprechung fort. Er stärkt die Rechte der auskunftsverlangenden Gesellschafter weiter. Tritt neben die Kaufabsicht das Interesse, Mitgliedsrechte informiert auszuüben, ist ein Auskunftsverlangen nicht rechtsmissbräuchlich. Diese Ansicht stärkt den Sekundärmarkt für geschlossene Fonds in Deutschland. Der BGH gibt auch zu erkenne, dass er eine vertragliche Beschränkung des Auskunftsrechts am Maßstab des § 166 Abs. 2 HGB messen und es für unwirksam erachten wird.
Ob der EuGH eine solche Auslegung und Anwendung des § 166 Abs. 2 HGB für vereinbar mit Art. 6 Abs. 1 UAbs. 1 DS-GVO hält, ist zweifelhaft. Die DS-GVO genießt vor dem nationalen Recht der Mitgliedstaaten Anwendungsvorrang. Was „für die Erfüllung eines Vertrags … erforderlich“ ist, muss daher unionsrechtlich autonom ausgelegt werden. Auch eine nach nationalen Recht vermeintlich unwirksame Regelung in einem Vertrag ist Teil des Vertrags und bestimmt, was zur Erfüllung des Vertrags erforderlich ist. Dafür spricht der Sinn des Art. 6 Abs. 1 UAbs. 1 b) DS-GVO, der es den Vertragsparteien überlässt, über die Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung selbst zu bestimmen. Die nationalen Gerichte und insbesondere der BGH werden daher eine vertragliche Beschränkung des Auskunftsanspruch zu beachten haben.