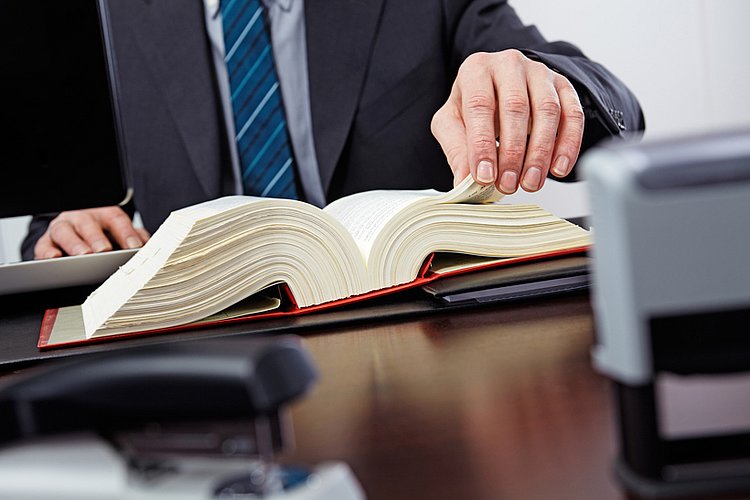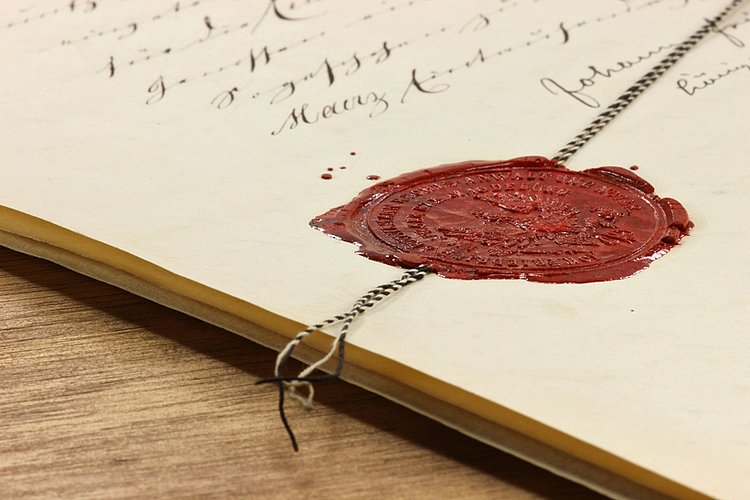Stiftung – echt jetzt? Ein kleines „Stiftungs-1x1“
Stiftung: Was ist das?
Eine Stiftung ist eine eigene Rechtspersönlichkeit, die keine Gesellschafter oder Mitglieder hat und nicht auf bestimmte Zeit, sondern „für die Ewigkeit bestimmt“, errichtet wird – mit dem Zweck, ihre Erträge für die satzungsgemäß vorgegebenen Zwecke zu verwenden. Die Stiftung ist steuerbegünstigt, wenn sie ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke verfolgt (sog. gemeinnützige Stiftung). Diese darf nur in geringem Umfang Erträge (maximal 1/3) zur angemessenen Versorgung von Familienmitgliedern verwenden.
Gleichermaßen kann eine Stiftung auch ausschließlich eigennützige Zwecke verfolgen, beispielsweise die dauerhafte finanzielle Versorgung von Familienmitgliedern (sogenannte eigennützige Stiftung oder Familienstiftung). Da die Familienstiftung keine steuerbegünstigten Zwecke verfolgt, entfallen die Steuerprivilegien der gemeinnützigen Stiftung. Die Überwachung durch die Stiftungsbehörde erfolgt je nach Bundesland allenfalls eingeschränkt.
Neben rein gemeinnützigen oder ausschließlich eigennützigen Stiftungen sind auch Mischformen oder Gestaltungen möglich, die beide Zwecke vereinen.
Aus rechtlicher und steuerlicher Sicht ist die Stiftungsform eine hochinteressante Gestaltungsoption – sei es zur langfristigen Vermögensbindung, zur Verwirklichung gemeinnütziger Ziele oder zur Nachfolgeplanung.
Startkapital: Wie viel ist erforderlich?
Bei der Errichtung einer Stiftung wird diese mit einem sog. Grundstockvermögen ausgestattet, das grundsätzlich dauerhaft zu erhalten ist. Nach den gesetzlichen Vorgaben muss die dauernde und nachhaltige Erfüllung des Stiftungszwecks gesichert sein (es sei denn, es handelt sich um eine Verbrauchsstiftung, siehe dazu unten). Die Erträge aus dem Grundstockvermögen werden für den Zweck verwendet. Die Höhe des Grundstockvermögens bemisst sich daher nicht pauschal, sondern richtet sich nach dem konkreten Finanzbedarf für die satzungsgemäße Zweckverfolgung. In der Regel wird es nicht sinnvoll sein, eine Stiftung mit einem Grundstockvermögen von weniger als 250.000 € auszustatten, grundsätzlich sollten mindestens 500.000 € zur Verfügung stehen. Zudem ist auf die Gepflogenheiten der Stiftungsbehörde abzustellen, deren Vorgaben in den jeweiligen Bundesländern unterschiedlich sind. Spätere Erhöhungen des Grundstockvermögens sind grundsätzlich möglich.
Organe der Stiftung: Wer hat das Sagen?
Die funktionale Organisation der Stiftung ist Sache des Stifters. Dieser bestimmt im Rahmen der Errichtungsdokumente auch, welche Gremien die Stiftung haben soll. Nach den gesetzlichen Vorgaben muss die Stiftung mindestens einen Vorstand und kann einen Beirat haben. Einzelheiten dazu, insbesondere die Frage, welche Rechte dem Vorstand zustehen und in welchem Umfang Rechte auf den Beirat delegiert bzw. Überwachungsaufgaben übertragen werden, regelt der Stifter in der Stiftungssatzung bei Errichtung der Stiftung. Häufig wird der Beirat erst nach Ausscheiden des Stifters etabliert oder jedenfalls dessen Rechte gegenüber dem Vorstand gestärkt, damit der Fremd-Vorstand durch den Beirat effektiv überwacht werden kann. Die Anzahl von Vorstands- und Beiratsmitgliedern wird auch davon abhängig sein, wie umfangreich die Stiftungstätigkeit perspektivisch sein wird.
Zudem sollte bereits bei Errichtung der Stiftung eine klare Regelung zur Nachfolge im Vorstand – insbesondere für den Zeitpunkt des Ausscheidens des Stifters aus diesem Gremium – getroffen werden, um die Handlungsfähigkeit der Stiftung langfristig zu sichern.
Errichtung der Stiftung: Wann ist der richtige Zeitpunkt?
Die Stiftung kann zu Lebzeiten des Stifters errichtet werden, aber auch letztwillig, also im Wege von testamentarischen Anordnungen. Für die lebzeitige Errichtung einer Stiftung bestehen keine besonderen Formvorschriften. Zur Errichtung muss das Stiftungsgeschäft und die Stiftungssatzung der zuständigen Stiftungsbehörde vorgelegt werden. Die Stiftung entsteht sodann mit Anerkennung durch die Stiftungsbehörde.
Wenn die Stiftung erst für den Fall des Ablebens des Stifters errichtet werden soll, sind die Formvorschriften für letztwillige Verfügungen zu beachten (handschriftlich oder notariell). Wird die Stiftung auf den Todesfall notariell beurkundet, richten sich die Gebühren nach dem Wert des Vermögens, das in die Stiftung eingebracht wird. Es empfiehlt sich daher stattdessen lebzeitig eine Stiftung mit geringerem Grundstockvermögen zu errichten und testamentarisch zu verfügen, dass ein weiterer Nachlassgegenstand beispielsweise zur Erhöhung des Grundstockvermögens der Stiftung zugewendet wird. Die lebzeitige Errichtung hat für den Stifter zusätzlich den Vorteil, dass er als Vorstand gerade zu Beginn der Stiftungstätigkeit deren Handeln steuern und damit prägen kann. Dies hat für die späteren Gremienmitglieder den positiven Effekt, dass sie auf den bereits gelebten Stifterwillen abstellen und ihr Handeln danach ausrichten können.
Ewigkeitsgedanke: Stiftung und kein Ende? Die Verbrauchsstiftung
Grundsätzlich ist eine gemeinnützige Stiftung anzuerkennen, wenn das Stiftungsgeschäft den gesetzlichen Anforderungen entspricht und die dauerhafte und nachhaltige Erfüllung des Stiftungszwecks gesichert erscheint. Als Ausnahme hiervon ist es möglich, eine sogenannte Verbrauchsstiftung zu errichten. Diese ist anzuerkennen, wenn die Satzung eine Laufzeit von mindestens 10 Jahren vorsieht. Statt dem Grundstockvermögen besteht das Stiftungsvermögen einer Verbrauchsstiftung nur aus sonstigem Vermögen, das nach den satzungsmäßigen Vorgaben zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu verbrauchen ist. Anders als bei der „auf Ewigkeit“ angelegten Stiftung dürfen somit nicht nur die Erträge, sondern das gesamte Stiftungsvermögen über einen Zeitraum von zehn Jahren für den Stiftungszweck nach den Vorgaben der Satzung verbraucht werden.
Die Stiftung kann schon bei der Errichtung als Verbrauchsstiftung ausgestaltet werden, alternativ besteht die Möglichkeit, in der Satzung optional die Umwandlung in eine Verbrauchsstiftung bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen vorzusehen.
Es gibt einige Gründe, die für eine Verbrauchsstiftung sprechen können. Angesichts des anhaltend niedrigem Zinsniveaus lassen sich gemeinnützige Zwecke oft nicht ausschließlich aus den Erträgen realisieren. Die Stiftungsbehörden empfehlen bei einem angedachten Grundstockvermögen von weniger als 1 Mio. Euro teilweise sogar die Verbrauchsstiftung. Diese Stiftungsform eignet sich zudem für Projekte oder Vorhaben, die auf eine bestimmte Dauer angelegt sind (z. B. ein wissenschaftliches Forschungsprojekt oder Bau eines Krankenhauses) oder wenn ein Projekt für einen bestimmten Zeitraum mit genau definierten Beträgen gefördert werden soll. Nachteilig wirkt sich hingegen aus, dass die Verbrauchsstiftung nicht die steuerlichen Begünstigungen einer auf Dauer angelegten Stiftung beanspruchen kann.
Fazit
Die Errichtung einer Stiftung kommt in Betracht, wenn ein freies Vermögen von mindestens 500.000 € zur Verfügung steht.
Wenn die Stiftung steuerbegünstigt sein soll, ist zwingend eine gemeinnützige Stiftung zu errichten, deren Zweck ausschließlich und unmittelbar dem Gemeinwohl dient.
Die letztwillige Errichtung einer Stiftung ist möglich, aber nur eingeschränkt empfehlenswert.
Die Stiftung kann auch als Verbrauchsstiftung errichtet werden, mit dem Vorteil, dass das eingebrachte Kapital als sonstiges Vermögen über einen Zeitraum von 10 Jahren für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden kann.
Die obigen Ausführungen zeigen bereits auf: Eine sorgfältige Planung und individuelle Beratung insbesondere hinsichtlich der richtigen Stiftungsform sind bei der Stiftungsgründung unerlässlich, um die persönlichen Ziele optimal umzusetzen und rechtliche sowie steuerliche Fallstricke zu vermeiden.